Die Geschichte von Tom
Die Geschichte von Tom
Tom war 12 als er zu uns auf Station kam.
Er war ein schwerstbehinderter Junge, musste über eine Sonde, die über die Bauchdecke in den Magen gelegt wurde, ernährt werden. An einem seiner Finger oder Zehen klebte ständig ein kleiner Sensor mit einem roten Licht. So sah man, wie viel Sauerstoff in seinem Blut war. Der Puls wurde damit auch ermittelt und beides konnte man auf einem kleinen Monitor, der mit Tom verbunden war, ablesen.
Er konnte nicht sprechen, sich kaum allein bewegen und wenn der Monitor Alarm gab, bekam er eine Maske mit Sauerstoff auf sein Gesicht.
Tom kam mit einer Frau, wir gingen davon aus, dass sie seine Mutter ist.
Auf dem Belegungszettel, den wir vor jeder Schichtübergabe aktualisieren, stand ihr Name. Und der von Tom.
Sie hatte einen anderen Familiennamen als er, in der heutigen Zeit allerdings nichts Ungewöhnliches.
„Hallo, ich bin Schwester Jeannine, ich bin heute für sie zuständig. Herzlich Willkommen auf Station. Jetzt packen sie erst einmal in Ruhe aus und danach zeige ich ihnen unsere Station und wir gehen gemeinsam die Aufnahme durch.“
Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass der erste Kontakt und das, wenn möglich ruhige Ankommen der kleinen Patienten und ihrer Angehörigen den Weg für den kompletten Aufenthalt ebnet.
Kurze Zeit später standen Mama und Tom vor mir.
„Wir sind bereit.“ Sagte sie und lächelte entspannt.

Ich mag es, wenn die Atmosphäre des Ankommens so ruhig ist. Das ist für alle beteiligten am angenehmsten, lässt sich aber natürlich nicht immer einhalten.
„Na Tom? Bist du aufgeregt?“
Ich bekam keine Reaktion. Er saß in seinem Rollstuhl, über die PEG-Sonde lief seine Nahrung.
„Ich glaube, du wirst dich hier noch einleben, hab keine Angst, wir erklären dir alles.“ Sagte ich zu Tom und seine Mutter streichelte ihm währenddessen sanft über die Hand.
„Er ist aufgeregt.“ Sagte sie zu mir. „Er würde sonst eine Reaktion zeigen. Keine Reaktion ist sein Ausdruck von Nervosität. Außerdem wird selten mit ihm gesprochen, fremde Leute sprechen immer mit mir über ihn.“
„Aha..“ rutschte mir verwundert raus. Ich musste mich aber an den Beginn meiner Arbeit mit Kindern mit Behinderung erinnern. Es fiel mir damals schwer, mit Menschen zu sprechen, die mir verbal nicht antworten konnten.
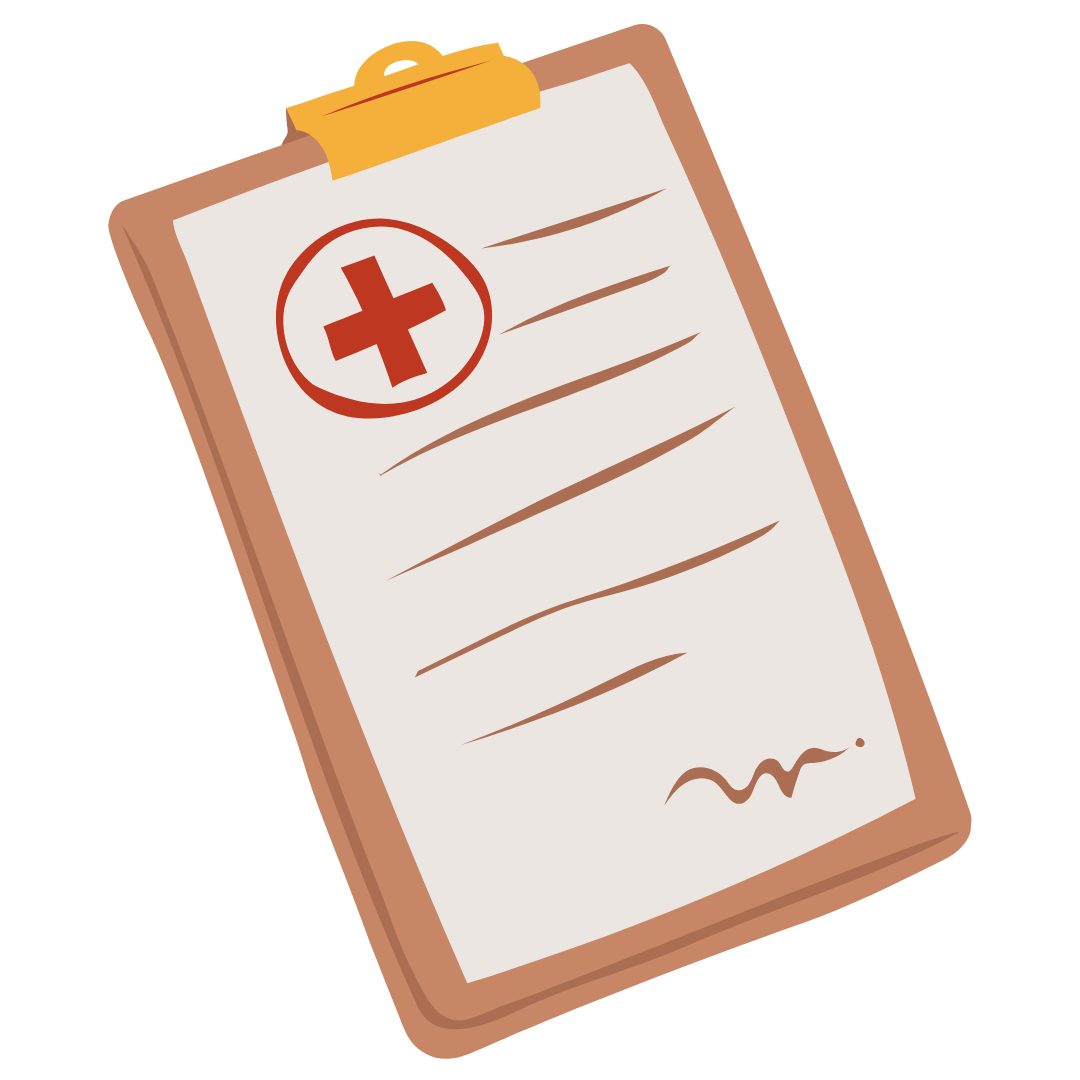
Wir begannen das Aufnahmegespräch. Während ich mich mit der Mutter von Tom unterhielt ihr Fragen zum Gesundheitszustand und ihrem Weg von Geburt bis heute stellte, wurde Tom dennoch mit ins Gespräch eingebunden.
Es stellte sich heraus, dass Tom ein sogenanntes Extremfrühchen war. 23. Schwangerschaftswoche, 423 g. Er wurde mehrfach operiert, es war nie klar wie schwer er behindert sein würde und was er erlernen wird und was nicht.
Im 6. Lebensmonat wurde Tom aus der Klinik entlassen.
Seine leibliche Mutter hatte bereits 2 kleine Kinder und sie wäre der Herausforderung, die Tom ihr bot, nicht gewachsen gewesen.
Sie lies ihn im Krankenhaus zurück und gab ihn zur Pflege frei.
Und die Frau, an Toms Seite, die mir gegenübersaß, war seine Pflegemutter.

In manchen Köpfen rattert es jetzt bestimmt.
„Wie kann man nur, sein eigenes Kind.“
„So eine Rabenmutter.“
„Armer Tom, so ohne Mutter.“
Solche und auch andere Sätze sind sehr symbolisch dafür, was ich auch in der Arbeit mit diesen Kindern erlebe.
Toms Pflegemutter erzählte, dass Tom zwar körperlich behindert ist, sein Gehirn aber, bis auf kleine Einschränkungen sehr gut funktioniert.
„Stimmts?“ sagte sie zu Thom lächelte und gab ihm einen Stups an seine Schulter.
So von außen betrachtet sah er nicht aus wie jemand der in die Schule gehen oder lesen und schreiben konnte, ich selbst wusste aber, welche Fähigkeiten in diesen Kindern stecken.
Ein pfeifendes Geräusch hallte durch den Raum.
Außer mich, schien das niemanden zu beunruhigen.
„Das ist normal.“ Hörte ich sie sagen. „Tom hält immer die Luft an, wenn es unangenehm wird. Wenn wir über Diagnostik sprechen, wenn es darum geht, dass er zum Blut abgenommen werden muss, eben alles was unangenehm ist.
Manchmal möchte er einen Film anschauen oder etwas anderes tun als zum Beispiel zu Therapie zu fahren, wenn er darauf keine Lust hat, macht er das auch. Ich kann sehr gut entscheiden was bedrohlich für Tom ist und womit er seine Bedürfnisse einfordert.“
Sie erzählte mir, dass sie gerade damit beginnen, Tom einen Sprachcomputer zu ermöglichen. Das ist eine Art Tablet, die technisch so funktioniert, das Tom mit seinen Augen über kleine Symbole schauen kann und der Computer dann für ihn spricht. Natürlich sind das oft keine kompletten Sätze aber JA und NEIN funktionieren schon hervorragend. „Er soll damit einfach die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben haben.“
Ich kenne unterstützte Kommunikation, ich kenne Menschen, die mit unterstützter Kommunikation einen sehr großen Mehrwert bekommen, die mit unterstützter Kommunikation einfach all das äußern können, was ihnen ein Bedürfnis ist und natürlich auch, was sie nicht wollen.
Nein sagen ermöglichen!
„Na? Das zeigst du mir mal, wenn du deinen Computer mal ausgepackt hast.“ sagte ich zu Tom und lächelte ihn an. Und in diesem Moment bekam ich ein Lächeln zurück.
Die komplette Aufnahme mit der Geschichte von Tom mit der Geschichte der Mutter mit ein paar persönlichen Erlebnissen dazwischen dauerte fast eine ganze Stunde. Warum? Weil es für uns als Pflegekräfte extrem wichtig ist, jedes noch so kleinste Detail über diese Kinder zu erfahren. Die Eltern sind als Ressource dabei, aber sie sind keine Pflegekräfte. Wenn die Mutter sich eine Auszeit nimmt, müssen wir einfach wissen, wie Tom es äußert, wenn er bestimmte Dinge möchte, Schmerzen hat oder umgelagert werden möchte.
Während seines Aufenthaltes bekam ich immer mehr Einblick in Toms Welt. Und es gab die kleinen, persönlichen Gespräche zwischen seiner Mutter und mir.
Wir sprachen viel über Toleranz, über Inklusion und auch über Pflegeeltern.

„Wissen sie, Toms Mutter wird oft verurteilt. Weil sie ihn nicht wollte. Ich finde es sehr stark von ihr. Sie hat sich gegen ihr eigenes Kind entschieden, weil sie es nicht schafft. Sie wollte, dass es ihm gut geht. Das er nicht darunter leidet, dass sie nicht damit klarkommt. Das ist unfassbar mutig.“
„Und… Sätze wie: „Das arme Kind mit seiner Behinderung“ hängen mir wirklich zum Hals raus. Tom kennt es nicht anders. Er ist nicht arm. Sein Leben ist so wertvoll. Ich habe auch schon gehört, es wäre wohl besser er hätte damals nicht überlebt. Mir tut es nicht mehr weh, aber ich weiß, dass es was mit unseren Kindern macht. Tom kennt es nicht anders. Sein Leben besteht aus all dem, was wir ihm bieten können. Wir fahren in Urlaub, er bekommt Therapie, hat Kontakte zu anderen Kindern, lacht, weint. Er fühlt anders als wir aber deswegen nicht schlechter. Ist ein Leben, nur weil es anders ist, nicht lebenswert?“
Mich machen solche Gespräche nachdenklich. Mein Sohn kam selbst als Frühgeborenes zu Welt und hat eine Behinderung. Nicht so schwer wie bei Tom, aber sie ist da. In einer Zeit, in der wir Gendern, mit vielen verschiedenen Kulturen zusammenleben, in der wir uns für mehr Toleranz und Verständnis einsetzten, sollte Inklusion eigentlich kein Thema mehr sein.
Die Arbeit mit Kindern und erwachsenen Menschen mit Behinderung ist anders. Auch im Krankenhaus. Allein um wirklich gut auf die Patienten eingehen zu können, braucht es Tage.
Weil Zeit und Vertrauen hier oft ganz nah beieinander sind. Weil Stress und Hektik Gift für die Körper sind, die sich oft nur durch langsame und Ruhige Maßnahmen bewegen lassen. Menschen mit Behinderung haben Angst, ihnen fehlt oft das Verständnis für manche Untersuchungen. Fingerspritzengefühl und Aufklärung. Den Menschen da abholen, wo er steht.
Leider findet dieses Thema in der Pflegeausbildung und auch im medizinischen Studium viel zu wenig Bedeutung. Pflegekräfte haben Angst, sind sich unsicher die Zeit ist knapp. Dadurch entsteht Unsicherheit und Angst, für mich völlig verständlich.
Inklusion und Krankenhaus ist nicht möglich. Nicht im Jahr 2021. Weil ein Mensch mit Behinderung auf einer Normalstation untergeht. Wir können dort, unter diesem Druck nicht so viel Zeit investieren, wie es diese Menschen brauchen.
Ich wünsche mir mehr Offenheit. Von der Gesellschaft und von meinen Kolleg:innen. Aber auch die Politik muss endlich erkennen, mit wieviel Diversität wir jeden Tag zu tun haben.
Mit dieser Geschichte wollte ich euch zeigen, dass es oft gar nicht so aussieht, wie es scheint. Das Behinderung nicht gleich Behinderung ist und dass Menschen, die Körperlich eingeschränkt sind, nicht unbedingt eine geistige Behinderung haben. Andersrum ist es übrigens genauso.
Auch wenn der Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht von heute auf morgen erlernt werden kann, hat euch dieser Beitrag vielleicht ein Stück weit geholfen, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen.